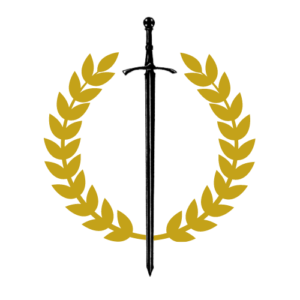Einige terminologische Klarstellungen
Zunächst einmal ist es wichtig, zwischen Rasse und Ethnizität zu unterscheiden, obwohl beide Begriffe im modernen Diskurs oft synonym verwendet werden. Der Begriff Ethnizität stammt vom griechischen Wort ethnos (bedeutet „ein Volk“ oder „Nation“) und bezieht sich in der Regel auf eine Gruppe von Menschen mit einer gemeinsamen historisch-kulturellen Identität, einschließlich Sprache, Bräuchen, Geografie und Religion. Die Rasse hingegen basiert ausschließlich auf biologischen Merkmalen (wie Haut-, Augen- und Haarfarbe), dennoch entstanden aus diesen Merkmalen eine Vielzahl von Vorstellungen über das Wesen oder den Wert von Personen einer bestimmten Rasse.
Das Wissen über verschiedene Völker und Kulturen ist so alt wie die Schrift selbst. Klassische Werke der Antike wie Herodots „Historien“ und Platons „Gesetze“ sind nur zwei Beispiele für philosophische Untersuchungen der unterschiedlichen Lebensweisen anderer Völker und ihrer relativen Vorzüge. Das Alte Testament ist voll von Beobachtungen über die Unterschiede zwischen dem auserwählten Volk Gottes – Israel – und den zahlreichen Stämmen, Nationen und Reichen, die eine oder mehrere falsche Religionen und die daraus resultierenden Praktiken angenommen hatten.
Mit dem Aufkommen des Christentums verloren ethnische Unterschiede nicht so sehr an Bedeutung, sondern begannen vielmehr, an Kraft zu verlieren. Während des Aufstiegs des Byzantinischen Reiches als „Neues Römisches Reich“ und Konstantinopels als Machtzentrum war jene „ethnische Frage“ von vorrangiger Bedeutung, ob eine Person oder Personen Christus akzeptierten oder nicht. Die familiäre Herkunft und die praktischen Vorteile, die durch Erbschaft und politische Verbindungen erworben wurden, spielten zwar weiterhin eine Rolle, aber die Vorstellung davon, was es bedeutete, Teil des Reiches zu sein – mit anderen Worten, ein Römer zu sein –, hatte radikal weniger mit sprachlichen Unterschieden und kulturellen Zufällen zu tun als vielmehr mit der religiösen Ausrichtung. Diese „ökumenische Sichtweise“ (mangels eines besseren Begriffs) sollte im ersten Jahrtausend nach Christus auf die Probe gestellt werden, als der Ausbruch von Häresien, Spaltungen und schließlich der Aufstieg einer neuen falschen Religion (Islam) die universalistischen, panethnischen Herrschaftsansprüche Byzanz‘ untergruben.
Wie weiter unten noch näher erläutert wird, erneuerte das Wiederaufleben Westeuropas und die Entwicklung des Christentums die universelle Sichtweise des Evangeliums, dass alle Völker zu allen Zeiten und an allen Orten in Christus vereint sind, auch wenn sie ihn noch nicht angenommen haben. Allerdings musste sich der Westen ebenso wie der Osten im Laufe der Jahrhunderte mit einer Reihe von Umbrüchen auseinandersetzen, die in der Reformation ihren Höhepunkt fanden, in der das Christentum entlang religiöser, politischer und schließlich nationaler Grenzen zerbrach. In den folgenden Jahrhunderten begannen die zunehmenden mannigfaltigen Erforschungen des Menschen in Verbindung mit postchristlichen Ideen, biologische Merkmale stärker in den Vordergrund zu rücken, nicht nur als Grundlage dafür, wie ein Volk ein anderes behandelte, sondern schließlich auch dafür, wie eine einzelne Nation oder Gesellschaft ihre eigenen Mitglieder behandelte.
Ideen versus Theorie
Während im letzten Jahrhundert eine Fülle von Literatur über die Ursprünge der Rassenidee und des Rassismus geschrieben wurde, stammen zwei Werke von bleibender intellektueller Bedeutung aus der Feder des österreichischen Emigranten und Philosophen Eric Voegelin: Rasse und Staat und Die Rassenidee in der Geistesgeschichte, beide 1933 im Schatten des nationalsozialistischen Deutschlands veröffentlicht. Voegelin, der nicht zuletzt wegen seiner Kritik am Nationalsozialismus und den rassistischen Ideen der Nazis vor der Gestapo fliehen musste, lieferte wichtige Erkenntnisse über die Idee der Rasse und entlarvte gleichzeitig ihre pseudowissenschaftlichen Ursprünge. Man muss nicht alle Analysen Voegelins in diesen beiden Werken teilen, um seine entscheidende Unterscheidung zwischen Rassentheorie und Rassenvorstellung zu akzeptieren.
Rassentheorien versuchen laut Voegelin ebenso wie jede andere Theorie, die Realität zu erklären, und können daher hinsichtlich ihrer Prämissen, Logik und Rationalität intellektuell hinterfragt werden. Die Rassentheorien, die Voegelin in Rasse und Staat auf den Prüfstand stellt, scheitern wiederholt an ihrer kurzsichtigen Betrachtung der Wechselbeziehung zwischen Geist, Körper und Seele, wobei der Körper – also physische Merkmale und Eigenschaften – als Quelle sowohl des Geistes als auch der Seele angesehen wird (sofern die „Seele“ überhaupt berücksichtigt wird). Diese Theorien reduzieren den Menschen auf eine Reihe biologischer Funktionen und Eigenschaften und sind daher stets unzureichend. Darüber hinaus untergräbt die Willkür, mit der viele vermeintliche Theoretiker das Thema Rasse angehen, insbesondere in Bezug auf die Kategorisierung verschiedener Völker und ihrer angeblichen gemeinsamen Merkmale, den Wert ihrer Schlussfolgerungen zusätzlich.
Im Gegensatz zur Rassentheorie stehen die Rassenidee oder -ideen, die versuchen, sich jenseits jeder Widerlegung zu positionieren. Auch wenn sie den Anschein erwecken, „biologisch” und damit „wissenschaftlich” zu sein, gehen sie doch als Symbole von politischen Gemeinschaften aus. In einem Essay aus dem Jahr 1940 in der Zeitschrift Review of Politics, in dem er seine früheren Bücher zusammenfasst, „The Growth of the Race Idea“ (Das Wachstum der Rassenidee), stellt Voegelin fest, dass Rassenideen keine Theorien sind; sie geben nicht vor, die Realität zu beschreiben. Stattdessen sind sie „Symbole . . . die die Funktion haben, das Bild einer Gruppe als Einheit zu schaffen“. So wurde die Rassenidee des „Arianismus“ zu einem Symbol für die Nazis, um sich als einheitliches Volk zu präsentieren, obwohl jede ehrliche historische Untersuchung die geografische Vielfalt der Menschen zeigen konnte, die das als Deutschland bekannte Land besiedelten. Andere Rassenideen scheitern angesichts der empirischen Realität an ähnlichen Schwierigkeiten.
Rassismus nach dem Christentum
In Anlehnung an Voegelins Essay aus dem Jahr 1940, der vielleicht leichter zugänglich ist als seine früheren Bücher, lohnt es sich, Voegelins Identifizierung der Rassenidee und des Rassismus als postchristliches, ja sogar heidnisches Phänomen hervorzuheben. Der radikale Partikularismus der Rassenidee bricht entscheidend mit der aus der Theologie des hl. Paulus entwickelten Theorie vom mystischen Leib (corpus mysticum) Christi. So wie die Menschheit einen gemeinsamen biologischen Vorfahren in Adam hat, so hat sie nun auch einen gemeinsamen spirituellen Vorfahren oder Oberhaupt in der Person Jesu Christi. Hier ist Voegelins erste Zusammenfassung:
„Die Idee des mystischen Leibes basiert auf der Interpretation der Personen Christi und der Menschen. Beide bestehen aus dem Körper, dem Soma, und dem Geist, dem Pneuma. Die Vereinigung zwischen der menschlichen Gemeinschaft und Christus wird durch die doppelte Natur Christi als Mensch und Gott gewährt. Jedes Mitglied, das in die Gemeinschaft, die ecclesia, aufgenommen wurde, hat Anteil am pneuma Christi. … Christus, der in den Mitgliedern der Gemeinschaft lebt, bildet das geistige Band zwischen ihnen.“
Voegelin betont weiter, dass diese Vorstellung die Persönlichkeit Christi nicht in der Vielzahl derjenigen „auflöst“, die die Ekklesia bilden, da Christus, wie der heilige Paulus in Kol 1,18 lehrt, „das Haupt des Leibes, der Kirche“ ist. Ausgehend von Thomas von Aquins Summa, Tertia Pars, q. 8, art. 3, betont Voegelin, dass sich die Position Christi als Haupt des mystischen Leibes nicht nur auf diejenigen erstreckt, die formell Mitglieder der Kirche sind, sondern auf die gesamte Menschheit. Nicht alle Menschen sind Mitglieder des mystischen Leibes oder in Christus eingegliedert, aber alle haben Christus als ihren König, ob sie ihn anerkennen oder nicht.
„Möglich wurde diese Ausweitung durch die Unterscheidung zwischen Mitgliedschaft in actu und Mitgliedschaft in potentia. In potentia sind alle Menschen Mitglieder des mystischen Leibes, und Christus ist daher nicht nur das Haupt der Gläubigen, sondern aller Menschen: Er „ist der Retter aller Menschen, besonders derer, die glauben“ (1 Tim 4,10).“
Das soll nicht heißen, dass es durch Christus eine vollkommene Homogenität unter den Menschen gibt oder jemals gegeben hat. Bei einer weiteren Untersuchung der Schriften des heiligen Paulus erinnert Voegelin die Leser daran, dass durch Christus die Gaben Gottes vielfältig sind und den Mitgliedern des mystischen Leibes unterschiedliche Charismen verliehen werden. Eine andere Möglichkeit, dies zu verstehen, besteht darin, dass Gott seinem Volk unterschiedliche Stände verliehen hat; nicht alle Talente sind identisch oder gleich, aber sie werden nicht durch biologische Prozesse bestimmt. Und während grundlegende biologische Unterschiede, wie die zwischen Mann und Frau, darüber entscheiden können, wer für bestimmte Charismen wie das Priesteramt, das ausschließlich Männern vorbehalten ist, in Frage kommt, gehen das Priesteramt selbst und die Berufung dazu nicht aus der Biologie hervor. Sie kommen ausschließlich von Gott.
Der Zerfall des Christentums, insbesondere nach der Reformation, führte zu partikularistischen Vorstellungen von soziopolitischer Organisation. Da nicht mehr alle Menschen einem einzigen Leib, d. h. einer einzigen Kirche, angehörten und die von Paulus über Thomas von Aquin überlieferte universelle Vorstellung von Christus als Haupt der Menschheit auf theologischer Ebene von verschiedenen protestantischen Sekten angefochten wurde, entstanden neue Organisationsvorstellungen. Dieses Verlangen, das in der natürlichen Geselligkeit des Menschen verwurzelt ist, ist an sich nicht falsch. Ohne eine authentische katholische Vision, die ihnen als Leitbild diente, stellten die Menschen jedoch das Geistige zugunsten des rein Physischen, d. h. des Biologischen, zurück. Nicht alle Menschen, die in einem bestimmten geografischen Gebiet lebten, waren nun mehr katholisch, aber sie konnten alle „Arier” oder „Kaukasier” oder „Asiaten” sein und so weiter. Die spirituelle Existenz des Menschen verlor an Bedeutung zugunsten einer übermäßigen Betonung seiner rein physischen Existenz.
Die rassistischen Implikationen dieser Veränderung und die Reaktion der Kirche darauf werden in den folgenden Teilen dieser Reihe weiter untersucht. Dazu gehört auch die Untersuchung der Rolle, die die Theologie der Kirche dabei gespielt hat, Christen zu lehren, Christus in ihrem Nächsten zu sehen und allen Menschen Nächstenliebe entgegenzubringen, unabhängig von ethnischen oder willkürlichen rassischen Unterschieden.
Quelle: sspx.org