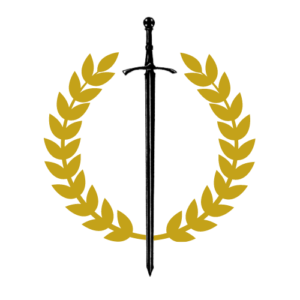Dieser Artikel ist eine kritische Analyse der Entwicklungen in der katholischen Kirche seit dem Zweiten Vatikanisches Konzil von Weihbischof emeritus Marian Eleganti und erschien im Original auf Lifesitenews.com.
Ich wurde 1955 geboren und war in meiner Kindheit ein begeisterter Messdiener. Zunächst diente ich im alten Ritus, immer etwas nervös, die lateinischen Antworten nicht zu vermasseln, dann wurde ich mitten im Geschehen für die sogenannte Neue Messe umgeschult.
Als Kind erlebte ich die Bilderstürmerei in der ehrwürdigen Heilig-Kreuz-Kirche meiner Heimatstadt. Die gotischen Schnitzaltäre wurden vor meinen Kinderaugen abgerissen. Was blieb, war ein Volksaltar, ein leerer Chorraum, das Kreuz im Chorbogen, Maria und Johannes links und rechts an weißen, kahlen Wänden. Neue Buntglasfenster, durchflutet von der aufgehenden Sonne im Osten. Nichts weiter: Es war ein beispielloser Kahlschlag. Wir Kinder fanden alles normal und passend und sammelten fleißig für den neuen Steinboden, um unseren Beitrag zur Reform oder Renovierung der Kirche zu leisten.Die Euphorie des Konzils wurde von den Priestern überall verbreitet, Synoden wurden einberufen, an denen ich selbst als Teenager teilnahm. Ich hatte absolut keine Ahnung, was vor sich ging.
Als 20-jähriger Novize erlebte ich die liturgischen Spannungen zwischen Traditionalisten und Progressiven unter den Reformern hautnah – und schmerzhaft. Neue kirchliche Berufe wurden eingeführt, wie der des (meist verheirateten) Pastoralassistenten. Ich erinnere mich an meine kritischen Kommentare dazu, denn die langsam spürbaren Spannungen und Probleme zwischen Geweihten und Nicht-Geweihten waren von Anfang an absehbar. Der Rückgang der Kandidaten für das Priestertum war vorhersehbar und zeigte sich bald.
Als junger Mann unterstützte ich das Konzil vorbehaltlos und studierte später seine Dokumente mit vertrauensvoller Hingabe. Dennoch fielen mir seit meinem 20. Lebensjahr einige Dinge auf: die Entsakralisierung des Chorraums, des Priestertums und der Heiligen Eucharistie sowie des Kommunionempfangs und die Mehrdeutigkeit einiger Passagen in den Konzilsdokumenten. Als junger Laie, der noch keine theologische Bildung hatte, bemerkte ich all dies sehr früh.
Obwohl das Priestertum seit meiner Kindheit die stärkste Option in meinem Herzen war, wurde ich erst mit 40 Jahren zum Priester geweiht. Ich wuchs mit dem Konzil auf, wurde erwachsen und konnte seine Auswirkungen seit seinem Abschluss beobachten. Heute bin ich 70 Jahre alt und Bischof.Rückblickend muss ich sagen, dass der Frühling der Kirche nie kam; stattdessen kam ein unbeschreiblicher Rückgang in der Praxis und im Wissen des Glaubens, eine weitverbreitete liturgische Formlosigkeit und Willkür (zu der ich selbst teilweise unwissentlich beitrug).
Aus heutiger Sicht betrachte ich alles mit zunehmender Kritik, einschließlich des Konzils, dessen Texte die meisten Menschen längst hinter sich gelassen haben, während sie immer seinen Geist beschwören. Was wurde in den letzten 60 Jahren nicht alles mit dem Heiligen Geist verwechselt und Ihm zugeschrieben? Was wurde als „Leben“ bezeichnet, das kein Leben brachte, sondern es vielmehr auflöste?
Die sogenannten Reformer wollten das Verhältnis der Kirche zur Welt neu überdenken, die Liturgie neu organisieren und moralische Positionen neu bewerten. Sie tun dies immer noch. Das charakteristische Merkmal ihrer Reform ist die Flüssigkeit in Lehre, Moral und Liturgie, die Anpassung an weltliche Maßstäbe und die nachkonziliare, rücksichtslose Abkehr von allem, was zuvor war.
Für sie ist die Kirche vor allem das, was sie seit 1969 ist (Editio Typica Ordo Missae, Kardinal Benno Gut). Was vorher war, kann vernachlässigt oder wurde bereits überarbeitet. Es gibt kein Zurück. Die revolutionärsten unter den Reformern waren sich ihrer revolutionären Akte immer bewusst. Doch ihre nachkonziliare Reform, ihre Prozesse, sind durchweg gescheitert. Sie waren nicht inspiriert. Der Volksaltar ist keine Erfindung der Konzilsväter.
Ich selbst feiere die Heilige Messe im neuen Ritus, auch privat. Aufgrund meiner apostolischen Tätigkeit habe ich jedoch die alte Liturgie meiner Kindheit wieder gelernt und sehe den Unterschied, besonders in den Gebeten und Haltungen und natürlich in der Ausrichtung.
Rückblickend erscheint mir die nachkonziliare Eingriffe in die fast 2.000 Jahre alte, sehr konsistente Form der Liturgie als eine eher gewaltsame, provisorische Rekonstruktion der Heiligen Messe in den Jahren nach dem Abschluss des Konzils, die mit großen Verlusten verbunden war, die angesprochen werden müssen. Dies geschah auch aus ökumenischen Gründen. Viele Kräfte, auch von der protestantischen Seite, waren direkt an diesem Bemühen beteiligt, die traditionelle Liturgie an die protestantische Eucharistie und vielleicht auch an die jüdische Sabbatliturgie anzugleichen. Dies geschah auf elitäre, disruptive und rücksichtslose Weise durch die Römische Liturgische Kommission und wurde von Paul VI. der gesamten Kirche auferlegt, nicht ohne große Brüche und Risse im mystischen Leib Christi zu verursachen, die bis heute bestehen.
Eines ist für mich sicher: Wenn man einen Baum an seinen Früchten erkennt, ist eine rücksichtslose und wahrheitsgetreue Neubewertung der nachkonziliaren liturgischen Reform dringend notwendig: historisch ehrlich und akribisch, nicht-ideologisch und offen, wie die neue Generation junger Gläubiger, die weder die Konzilstexte kennt noch liest. Sie haben auch kein Problem mit Nostalgie, weil sie die Kirche nur in ihrer heutigen Form kennen. Sie sind einfach zu jung, um Traditionalisten zu sein. Doch sie haben erlebt, wie Gemeinden heute funktionieren, wie sie Liturgie feiern und was von ihrer eigenen religiösen Sozialisation durch die Gemeinde bleibt: sehr wenig! Aus diesem Grund sind sie auch keine Progressiven.
Aus heutiger Sicht hat der liberale Katholizismus oder Progressivismus seit den 1970er Jahren, zuletzt in Gestalt des Synodalen Weges, ausgedient und die Kirche in eine Sackgasse geführt. Die Frustration ist entsprechend groß. Wir sehen es überall. Sonntags- und Werktagsgottesdienste werden hauptsächlich von älteren Menschen besucht. Junge Menschen fehlen, außer in einigen kirchlichen Hotspots, die selten sind. Die Reform kümmert sich um sich selbst, weil niemand mehr hingeht oder die Ergebnisse liest, ein ehernes Gesetz.
Wie kann die nachkonziliare Reform an diesem Punkt immer noch so unkritisch und engstirnig betrachtet werden, gemessen an ihren Früchten? Warum ist eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Tradition und unserer eigenen (kirchlichen) Geschichte immer noch nicht möglich? Warum will man nicht sehen, dass wir an einem Scheideweg stehen und Bilanz ziehen sollten, insbesondere liturgisch?
Ob es um Sein oder Nichtsein in Bezug auf Glauben und kirchliches Leben geht, entscheidet sich an der Liturgie. Hier lebt oder stirbt die Kirche. Traditionalisten und Progressive haben dies seit 1965 richtig erkannt. Warum also ist die Tradition bei jungen Menschen auf dem Vormarsch? Was macht sie für junge Menschen so attraktiv? Denken Sie darüber nach! Vielleicht sollten wir einfach die Richtung ändern! Verstehen Sie?
Bild: Liebermary – CC Wikimedia