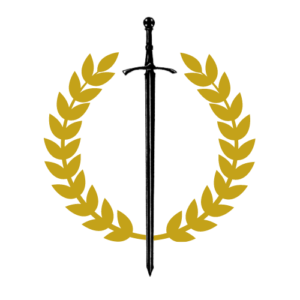Es bedarf weder der Bibel noch der Lehren der Kirche, um die Existenz Gottes zu erkennen – so argumentierte Thomas von Aquin. Die rechte Vernunft reicht aus, um durch einen Rückschluss von den Wirkungen in der Welt auf ihre Ursache, Gott, zu kommen. Seine berühmten „Fünf Wege“ zeigen, wie wir durch empirisch wahrnehmbare Phänomene Gottes Existenz erahnen können. Besonders der erste Weg, der von der Bewegung ausgeht, führt uns zu einem ersten unbewegten Beweger, der jede Veränderung im Hier und Jetzt ermöglicht. Doch wie steht es heute um solche Gottesbeweise? In einem Zeitalter, das sich als aufgeklärt versteht, scheinen sie überholt – vor allem durch die Kritik Immanuel Kants. Dieser Blogartikel beleuchtet, wie Thomas’ Denken mit der modernen Skepsis, insbesondere dem „kantianischen Dogma“, in Dialog tritt.
Der Mythos der Moderne: Vernunft ohne Gott?
Jedes Zeitalter hat seinen Mythos – eine große Erzählung, die Denken, Fühlen und Handeln prägt. Für die Moderne ist dies die Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts, die sich als erste Epoche wähnt, die Mythen hinter sich gelassen und sich allein auf die Vernunft gegründet hat. Doch genau darin liegt ihr eigener Mythos: die Vorstellung, keine großen Erzählungen mehr zu brauchen. Besonders der Glaube an einen allmächtigen, gütigen Schöpfergott wird als vernunftwidrig abgelehnt. Viele erklären sich, wie Jürgen Habermas in Anlehnung an Max Weber, für „religiös unmusikalisch“ oder flüchten in unverbindliche Spiritualität, um die Sehnsucht nach Transzendenz zu stillen.
Die Idee, dass Gottes Existenz durch Vernunft erkennbar sei, wirkt auf die meisten modernen Menschen unverständlich, wenn nicht gar anmaßend. Vernunft und Glaube stehen für sie in einem unversöhnlichen Gegensatz. Die Vernunft, so die Überzeugung, könne Licht ins Dunkel der Welt bringen, doch der Zugang zu etwas Transzendentem sei ihr verwehrt. Gott bleibe eine Frage des Glaubens – einer subjektiven Überzeugung ohne intellektuelle Grundlage.
Kant: Der „alles zermalmende“ Philosoph
Immanuel Kant, der Inbegriff aufklärerischen Denkens, prägt diese Sicht maßgeblich. Für ihn bedeutet Aufklärung „der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“. Anstatt gedankenlos Autoritäten zu folgen, solle der Mensch den Mut haben, seinen Verstand zu nutzen. Für Kant war dies ein revolutionärer Akt: Das selbstbestimmte Subjekt rückt ins Zentrum der Philosophie. Der Königsberger Philosoph, von Moses Mendelssohn als „alles zermalmender Kant“ gefeiert, wendet den Blick von der Wirklichkeit auf das erkennende Subjekt und fragt, wie Erkenntnis überhaupt möglich ist.
In seiner transzendentalen Philosophie kommt Kant zu dem Schluss, dass menschliche Erkenntnis beschränkt ist. Wir erkennen die Dinge nur, wie sie uns erscheinen, nicht wie sie an sich sind. Erkenntnis entsteht durch die Verbindung von Verstand (Begriffe) und Sinnlichkeit (Anschauungen). Ohne Sinnlichkeit wird uns kein Gegenstand gegeben, ohne Verstand keiner gedacht. Über die Dinge an sich – unabhängig von unserem begrifflichen und sinnlichen Apparat – lässt sich nichts sagen. Für die klassischen Themen der Metaphysik wie Gott, Seele oder Unsterblichkeit hat dies weitreichende Folgen: Da von Gott keine sinnliche Anschauung möglich ist, bleibt er ein leerer Begriff ohne Inhalt. Kants Kritik an Gottesbeweisen war so durchschlagend, dass in der akademischen Philosophie oft als Gewissheit gilt: Seit Kant seien Gottesbeweise erledigt. Dieses „kantianische Dogma“ prägt bis heute die Diskussion, insbesondere in der Theologie.
Das kantianische Dogma und seine theologischen Kinder
In Deutschland ist das kantianische Dogma besonders in der Theologie lebendig. Theologen wie Magnus Striet betonen, dass das Verhältnis von Gott und Mensch nicht von göttlicher Offenbarung, sondern von der Freiheit des Menschen her gedacht werden müsse. In einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk erklärte Striet 2018, die menschliche Vernunft könne das „Sehnsuchtswort“ Gott bilden, nicht aber dessen Existenz absichern. Das Unvermögen, Gottes Existenz sicher zu wissen, stehe im Zentrum der Moderne.
Doch Kant selbst war differenzierter. Er argumentierte, dass wir Gottes Existenz zwar nicht beweisen können, sie aber aus moralisch-praktischen Gründen annehmen müssen. Dennoch hat Kants Philosophie das traditionelle Gottesbild nachhaltig erschüttert. Viele Theologen, die sich auf Kant berufen, verwalten sein Erbe jedoch untreu, indem sie Gott als bloße Idee ohne reale Existenz betrachten. Für die Gegenwart scheint Gott „gestorben“, und das kantianische Dogma trägt dazu einen nicht unerheblichen Anteil bei.
Thomas von Aquin: Ein mittelalterlicher Gegenspieler
Dem kantianischen Dogma stellt sich das Denken eines mittelalterlichen Mönchs entgegen: Thomas von Aquin. Geboren um 1225 in Roccasecca, trat der junge Thomas dem Dominikanerorden bei und schuf mit seinem brillanten Intellekt eine einzigartige Synthese aus katholischer Theologie und aristotelischer Philosophie. Für Thomas ist Gott nicht nur ein Gegenstand des Glaubens, sondern auch der natürlichen Vernunft, die Gläubige wie Ungläubige gleichermaßen nutzen können. Es bedarf weder der Bibel noch der Kirche, um Gottes Existenz zu erkennen – die Vernunft reicht aus.
Besonders faszinierend ist Thomas’ Kritik am ontologischen Gottesbeweis, den Anselm von Canterbury im 11. Jahrhundert entwickelte. Anselm argumentierte, Gott sei „das, über dem nichts Größeres gedacht werden kann“. Wer diesen Begriff versteht, müsse Gottes Existenz anerkennen, da ein Gott, der nur im Verstand existiert, weniger vollkommen wäre als ein wirklich existierender Gott. Kant wies dieses Argument zurück, da Existenz kein „reales Prädikat“ sei, das einem Begriff hinzugefügt werden könne. Überraschenderweise hatte Thomas bereits Jahrhunderte zuvor eine ähnliche Kritik formuliert: Der Begriff Gottes (das, über dem nichts Größeres gedacht werden kann) impliziere nicht automatisch seine reale Existenz. Thomas unterschied zwischen dem begrifflichen Inhalt (Intension) und dem, worauf der Begriff verweist (Extension). Selbst wenn man versteht, was „Gott“ bedeutet, folgt daraus nicht, dass Gott wirklich existiert.
Die Fünf Wege: Ein empirischer Zugang zu Gott
Während Anselm Gottes Existenz durch reines Denken beweisen wollte, nehmen Thomas’ „Fünf Wege“ in der Summa Theologiae die sinnliche Erfahrung als Ausgangspunkt. Sie sind das Ergebnis jahrhundertelanger philosophischer Bemühungen und zeichnen sich durch ihre Klarheit und argumentative Dichte aus. Die Fünf Wege sind wie eine Gipfelwanderung: Sie beginnen im Basislager der sinnlichen Erfahrung und führen über Serpentinen zum Transzendenten – zu Gott.
Die Wege schließen von beobachtbaren Wirkungen in der Welt auf ihre Ursache. Thomas betont: „Obgleich Gott alles Sinnliche übersteigt, sind seine Wirkungen sinnlich wahrnehmbar, aus denen der Beweis dafür gewonnen wird, dass Gott ist.“ Jeder Weg beleuchtet Gott unter einem bestimmten Aspekt, sodass sie zusammen ein reichhaltiges Bild ergeben. Anders als bei Kant ist „Gott“ für Thomas kein leerer Begriff, sondern gewinnt seine Bedeutung aus den Wirkungen, auf die die Wege verweisen.
Der erste Weg: Der unbewegte Beweger
Betrachten wir den ersten Weg näher, der von der Bewegung ausgeht. Thomas beginnt mit einer einfachen Beobachtung: Es gibt Veränderung in der Welt – eine Tatsache, die unseren Sinnen offensichtlich ist. Dies ist der Ausgangspunkt, den Thomas als „besonders handfest“ bezeichnet. Sein zweites Prinzip lautet: „Alles, was bewegt wird, wird von einem anderen bewegt.“ Das lateinische motus umfasst dabei nicht nur Ortsveränderung, sondern jede Art von Veränderung.
Ein Beispiel: Eine Billardkugel rollt nicht von selbst, sondern wird von einem Queue oder einer anderen Kugel angestoßen. Ein heißer Kaffee wird nicht von selbst kalt, sondern durch die kühlere Raumtemperatur. Selbst Lebewesen, die sich scheinbar selbst bewegen, unterliegen diesem Prinzip. Thomas illustriert dies mit einer Anekdote: Bauern lassen ihre Arbeit liegen, um den imposanten Mönch zu bestaunen. Doch ihre Bewegung wird durch äußere Einflüsse ausgelöst – den Anblick Thomas’ oder den Gedanken an ihre Aufgaben. Selbst die „Selbstbewegung“ von Lebewesen ist letztlich durch etwas anderes bedingt.
Thomas stützt dieses Prinzip auf Aristoteles’ Unterscheidung zwischen Möglichkeit (potentia) und Wirklichkeit (actus). Veränderung ist der Übergang von einer realen Möglichkeit zur Wirklichkeit. Ein Besen hat die Möglichkeit, den Boden zu kehren, doch dazu braucht es einen wirklichen Arm, der ihn bewegt. Eine kalte Pizza hat die Möglichkeit, warm zu werden, doch es bedarf eines wirklichen Ofens. Thomas betont: Etwas kann nicht zugleich in derselben Hinsicht möglich und wirklich sein. Daher kann nichts sich selbst in derselben Hinsicht verändern – jede Veränderung erfordert ein anderes, bereits Wirkliches.
Der letzte Schritt: Kein unendlicher Regress
Aus dem Prinzip, dass jede Veränderung durch etwas anderes bewirkt wird, ergibt sich eine Kette von Verändertem und Veränderndem. Diese Kette kann entweder endlich sein – mit einer ersten, unveränderlichen Ursache – oder unendlich. Thomas argumentiert, dass ein unendlicher Regress im Hier und Jetzt absurd ist. Ohne eine erste Ursache, die selbst unverändert ist, wäre keine Veränderung erklärbar. Er vergleicht dies mit einem Stab, der nur bewegt, wenn eine Hand ihn führt, oder einem Zug, der ohne Lokomotive nicht fährt.
Entscheidend ist, dass Thomas hier keinen zeitlichen, sondern einen hierarchischen Regress meint. Die Beziehung zwischen Verändertem und Veränderndem ist simultan, nicht nacheinander. Ein unendlicher hierarchischer Regress wäre so absurd wie ein Pinsel, der von selbst malt, nur weil er einen sehr langen Griff hat. Daher muss es eine erste, unveränderliche Ursache geben – den unbewegten Beweger, den Thomas „Gott“ nennt.
Fazit: Thomas’ Herausforderung an die Moderne
Die Frage, warum dieser unbewegte Beweger mit Gott gleichzusetzen sei oder ob es nicht mehrere solcher Ursachen geben könnte, bleibt offen – ein Thema für weitere Diskussionen. Doch Thomas’ erster Weg zeigt, dass Gottesbeweise auch nach Kant möglich sind. Seine empirisch fundierten Argumente entziehen sich der kantianischen Kritik, da sie nicht auf rein begrifflicher Notwendigkeit, sondern auf sinnlicher Erfahrung basieren. Thomas fordert die Moderne heraus, ihre Vorurteile zu überdenken und die Vernunft nicht nur als Werkzeug der Weltdeutung, sondern auch als Weg zum Transzendenten zu nutzen.
In einer Zeit, die sich für mythenfrei hält, erinnert Thomas uns daran, dass die Vernunft nicht an der Oberfläche der Welt haltmachen muss. Seine Fünf Wege sind ein Angebot, die Gipfel des Denkens zu erklimmen – und vielleicht dabei Gott zu begegnen.