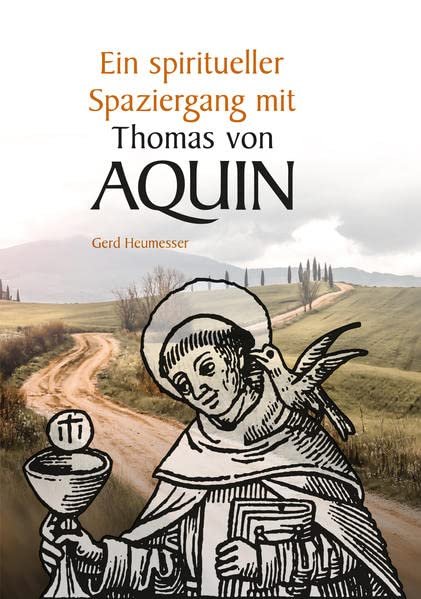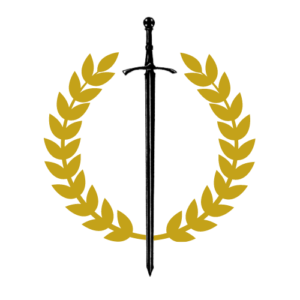Auf dem Wohnzimmertisch steht ganz unerwartet ein Blumenstrauß. Von selbst drängt sich uns die Frage auf: Wer hat ihn dahingestellt? In dieser konkreten Situation wenden wir einen allgemeingültigen Grundsatz an, nämlich den Satz: Alles, was ist, braucht eine passende Ursache. Dieser Grundsatz hilft uns hier weiter: Es ist ausgeschlossen, dass der Strauß von selbst entstand, und auch die Katze kann es nicht gewesen sein, sie ist keine passende Ursache für einen Blumenstrauß. Allgemeine Denk-Grundsätze helfen uns also, über konkrete Situationen richtig zu denken und richtig zu urteilen. Wie es Grundsätze gibt, die für unser Denken gelten, so gibt es auch allgemeingültige Grundsätze, die für unser Handeln gelten. Sie helfen uns, in konkreten Situationen das Richtige zu tun.
Die obersten Grundsätze für unser Handeln nennt der hl. Thomas von Aquin „ewiges Gesetz – lex aeterna“. Ein Gesetz ist eine Anweisung eines Herrschenden, die sagt, was zu tun oder zu lassen ist. Gott ist der Herr der Welt. Er lenkt alles durch seine Vorsehung. Er gibt allen Dingen Anweisungen. Durch das Erschaffen hat er angeordnet, wie die Dinge sein und handeln sollen. Die Sonne soll scheinen, die Vögel sollen fliegen und die Würmer kriechen. Die Menschen sollen vernünftig sein. Gott hat von Ewigkeit her an die Schöpfung gedacht, der Plan der Schöpfung lag in seinem Denken bereit, lange bevor er sprach: „Es werde“. In diesem Plan sind Anweisungen für alle Geschöpfe eingeschlossen. Daraus schließt Thomas: „Deshalb ist der Plan, durch den Gott als der Herrscher des Weltalls alles regiert, ein Gesetz.“ Und zwar ein ewiges Gesetz, weil es schon ewig in den Gedanken Gottes ist.
Zum Beispiel hat Gott sich schon immer den Menschen gedacht als ein Wesen, das nicht Gedanken lesen kann wie die Engel, das dafür aber sprechen kann. Er hat für den Menschen die Sprache vorgesehen als das Mittel, um Informationen auszutauschen.
Die DIN-Norm für Papier steht im Regelwerk des Instituts für Normung, sie ist aber auch in jedem genormten Blatt Papier. An einem DIN-A4-Bİatt kann man sie fast so gut ablesen wie aus dem Normen-Merkblatt.
So ist die Norm für die Schöpfung im Geist Gottes. Dieser Plan ist das, was die Regel festlegt und normt. Man kann sie aber auch aus den Geschöpfen herauslesen, denn sie sind das Genormte. Thomas sagt es so: „Da das Gesetz Regel und Richtmaß ist, kann es auf zweierlei Weise in jemandem sein: einmal in dem, der regelt und misst; das zweite Mal in dem, was geregelt und bemessen wird; denn etwas wird insoweit geregelt und gemessen, als es an einer Regel oder einem Richtmaß teilhat.“
So nehmen alle Geschöpfe am ewigen Gesetz Gottes teil. Sie sind so gebaut, wie es dem Plan Gottes entspricht. Dem Menschen hat Gott eine Hinneigung gegeben, dass er so handelt, wie es seinem Wesen entspricht. Zum Beispiel entspricht es dem Wesen des Menschen, durch die Sprache Informationen auszutauschen. Darum hat der unverdorbene Mensch die Neigung, die Sprache dafür zu benutzen, und scheut vor der Lüge zurück, denn die Lüge pervertiert die Sprache: Sprache ist da zur Information. Wer lügt, verwendet sie zur Desinformation.
Der gelehrte Heilige stützt sich auf ein Wort des hl. Paulus im Römerbrief: „Die Heiden erfüllen aus reinem Antrieb der Natur die Forderungen des Gesetzes.“
Durch diese Hinneigung zu dem, was dem menschlichen Wesen entspricht, nimmt der Mensch teil am ewigen Gesetz Gottes – wie das DIN-A4-Blatt an der DIN-Norm. Diese Teilnahme nennt Thomas „natürliches Gesetz – lex naturalis“.
Das ewige und das natürliche Gesetz sind die Grundsätze des menschlichen Handelns. Von diesen Grundsätzen müssen wir ableiten, wie wir in jeder konkreten Situation richtig handeln. Manche Situationen sind so häufig, dass es sich lohnt, die Anwendung schriftlich festzuhalten. Das geschieht durch menschliche Gesetze. Das Bürgerliche Gesetzbuch sagt zum Beispiel im § 123, dass Verträge anfechtbar sind, die jemand geschlossen hat, weil er von einem anderen arglistig getäuscht wurde.
Machen Gesetze die Menschen besser?
Aristoteles hatte zu dieser Frage eine klare Meinung: „Es ist der Wille eines jeden Gesetzgebers, dass er die Menschen zu guten Menschen macht.“ (Ethic, lib.1 cap. 13)
Der hl. Thomas von Aquin schließt sich dieser Lehre an und begründet das so: Ein Gesetz ist nichts anderes als die vernünftige Anordnung eines Leitenden, durch die er die Untergebenen lenkt. Die Aufgabe der Untergebenen ist es, gute Untergebene zu sein. Und auch hier stützt sich der heilige Lehrer wieder auf Aristoteles: „Die Tugend eines jeden Untergebenen besteht darin, dass er sich gut dem Oberen unterwirft.“ (Politeia, lib.1)
Gesetze helfen den Untergebenen, sich gut ihrem Oberen unterzuordnen. Das ist ja geradezu der Sinn eines jeden Gesetzes: Es fordert Gehorsam ein, leitet zum Gehorchen an. Wer das Gesetz befolgt, übt die Tugend, die ihm als Untergebenem zukommt. Wer Tugend hat, ist gut.
Hier aber unterscheidet Thomas zwei Arten von Gesetzen: die einen machen den Menschen schlechthin gut, die anderen nur in einer speziellen Hinsicht.
Wenn der Gesetzgeber durch seine Gesetze die Menschen zum Gemeinwohl (bonum commune) anleiten will, wie es dem Willen Gottes entspricht, dann macht ein solches Gesetz die Menschen schlechthin gut. Nicht alle Gesetzgeber genügen diesem hohen Anspruch.
Manchmal will der Gesetzgeber durch seine Gesetze nur erreichen, dass alles zweckmäßig abläuft, dass alle genügend Vergnügen haben, oder er will sogar mit seinen Gesetzen etwas erreichen, was dem Willen Gottes nicht entspricht. Solche Gesetze machen den Menschen nicht an sich gut, sondern sie machen ihn nur innerhalb eines solchen Regimes zu einem „guten“ Untertan. Er ist dann in dem Sinn ein „guter“ Untertan, wie man einen schlauen, erfahrenen Dieb einen „guten“ Dieb nennen kann.
Natürlich kann man dagegen einiges einwenden. Mit vier Einwänden setzt sich der gelehrte Heilige auseinander: Nicht Gesetze würden den Menschen besser machen, sondern nur die Tugenden. Dazu bemerkt Thomas, dass das Gesetz für die Tugenden eine wichtige Bedeutung hat. Das Gesetz will zu guten Gewohnheiten verhelfen. Gute Gewohnheiten aber sind sowohl für die erworbenen als auch für die von Gott eingegossenen Tugenden wichtig; freilich auf unterschiedliche Weise: „Bei beiden Arten von Tugenden bewirkt die Gewöhnung an das Tugendwerk etwas, aber auf unterschiedliche Weise: die erworbene Tugend wird gerade durch die Gewohnheit erworben; die eingegossene Tugend wird durch die Gewohnheit vorbereitet; und die eingegossene Tugend, die bereits vorhanden ist, wird durch die Gewohnheit bewahrt und gefördert.“
Ein anderer Einwand gibt zu bedenken, dass ein Mensch nicht gut werde, weil er dem Gesetz gehorche, sondern dass er schon gut sein müsse, damit er dem Gesetz gehorche.
Thomas weist diesen Einwand zurück, mit einem Argument, das seine Menschenkenntnis verrät: Nicht alle gehorchen dem Gesetz, weil sie tugendhaft und gut sind. Sondern manche gehorchen, weil sie sich vor der Strafe fürchten oder weil sie die Anordnung des Gesetzes einfach für vernünftig halten.
Der dritte Einwand weist auf Menschen hin, die sich den Gesetzen und der Allgemeinheit gegenüber zwar gut verhalten, in eigener Sache aber nicht gut sind.
Das ist für Thomas‘ Begriff von einer guten Gesellschaft schlichtweg unmöglich. Das Ganze kann nicht gut sein, außer es ist aus guten Gliedern zusammengesetzt. „Daher ist es unmöglich, dass es um das Allgemeinwohl einer Gesellschaft gutsteht, wenn nicht die Bürger tugendhaft sind, wenigstens die, denen es zukommt zu leiten.“
Wie aber steht es mit den Gesetzen eines Tyrannen? Ein Tyrann sucht nicht das Wohl seiner Untergebenen, sondern nur seinen eigenen Nutzen. Solche Gesetze können die Menschen doch nicht gut machen!In der Antwort des Heiligen zeigt sich wieder der Stellenwert, den bei ihm die Vernunft einnimmt: „Weil ein tyrannisches Gesetz nicht der Vernunft entspricht, ist es an sich kein Gesetz, sondern eine gewisse Verkehrtheit des Gesetzes, eine perversitas legis.“