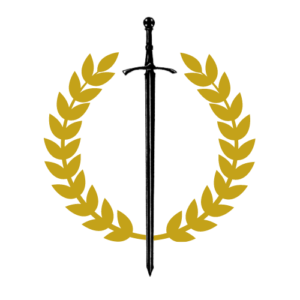Das Thema der Wahrheit hat mich von Beginn meiner philosophischen Laufbahn an fasziniert. Meine Doktorarbeit trug den Titel Erkenntnis objektiver Wahrheit, ursprünglich sogar Die Transzendenz des Menschen in der Erkenntnis. Später habe ich ein umfangreiches zweibändiges Werk mit dem Titel Wahrheit und Person verfasst, ebenso ein Buch über den Streit um die Wahrheit und ein weiteres über den Widersinn des Relativismus. Wie Sie sehen, habe ich mich intensiv mit dem Thema Wahrheit auseinandergesetzt. Ich halte es für eine grundlegende Frage.
Zu dieser Frage, was man unter Wahrheit versteht: Es gibt einerseits die wahre Erkenntnis der Wahrheit und andererseits zahlreiche falsche Wahrheitstheorien, die meines Erachtens schwerwiegende Auswirkungen auf Moral, Politik und das gesamte menschliche Leben haben. Dabei lassen sich verschiedene Grundbedeutungen von Wahrheit unterscheiden. Vermutlich beziehen Sie sich auf die Wahrheit des Urteils, also die Wahrheit einer Aussage. Daneben gibt es jedoch auch die ontologische Wahrheit, die sogenannte Seinswahrheit, die Erkenntniswahrheit oder die moralische, sittliche Wahrheit.
Beginnen wir mit der Seinswahrheit, die in der heutigen Philosophie selten diskutiert wird. Thomas von Aquin hat viel darüber geschrieben, ebenso Josef Pieper in seinem Buch über die Wahrheit des Seins. Dieser Begriff ist weniger geläufig, aber für mich äußerst wichtig. Seinswahrheit kann verschiedene Bedeutungen haben. Zum einen kann sie schlicht Wirklichkeit bedeuten. Eine wahre Begebenheit ist beispielsweise eine Begebenheit, die wirklich stattgefunden hat, im Gegensatz zu einer erfundenen Geschichte in einem Roman. Zum anderen kann man von wahrer Liebe sprechen, womit man nicht nur wirkliche Liebe meint, sondern eine Liebe, die dem Ideal oder Wesen der Liebe entspricht – im Gegensatz zu einer falschen, untreuen oder egozentrischen Liebe. Wahre Liebe beinhaltet eine gegenseitige Hingabe, eine Selbstschenkung und das Interesse am Wohl der geliebten Person. Ähnlich kann man von wahrer Gerechtigkeit oder wahrer Tugend sprechen. In diesem Sinne bedeutet ontologische Wahrheit entweder Wirklichkeit oder die Übereinstimmung eines Seins oder Aktes mit seinem wahren Wesen, also mit dem, was es idealerweise sein sollte.
Nun zur Wahrheit des Urteils, die vermutlich im Zentrum Ihrer Frage steht. Wenn wir ein Urteil fällen, etwa „Der Mensch ist sterblich“ oder „Gott ist Mensch geworden“, erheben wir einen Anspruch auf Wahrheit. Jedes Urteil, auch ein falsches, impliziert diesen Anspruch. Wahrheit des Urteils bedeutet hier, dass der ausgesagte Sachverhalt tatsächlich besteht, dass das Urteil mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Aristoteles sprach von der adequatio intellectus et rei, der Übereinstimmung von Intellekt und Sache. In der realistischen Phänomenologie präzisiert man dies als Übereinstimmung des Urteilsinhalts mit dem Sachverhalt. Ein Urteil wie „Der Mensch ist sterblich“ oder „Die Seele ist unsterblich“ ist nur dann wahr, wenn der Sachverhalt, den es beschreibt, tatsächlich besteht. Stimmt das Urteil nicht mit der Wirklichkeit überein, ist es falsch. Ein falsches Urteil kann ein Irrtum sein, wenn man sich ehrlich irrt, oder eine Lüge, wenn man absichtlich täuscht.
Dieser klassische Wahrheitsbegriff der Übereinstimmung mit der Wirklichkeit wird oft angezweifelt. Es gibt alternative Theorien, etwa den Relativismus, der behauptet, etwas sei für eine Person wahr, aber nicht für eine andere. Dieser subjektive Wahrheitsbegriff widerspricht jedoch dem Wesen der Wahrheit. Wenn etwas wahr ist, ist es für alle wahr, unabhängig von individuellen Meinungen. Die Idee, jeder habe „seine eigene Wahrheit“, wie etwa jede Religion ihre Wahrheit, ist ein verbreiteter Irrtum.
Ebenso falsch ist die Konsenstheorie, die Wahrheit als das definiert, worüber viele oder alle Menschen übereinstimmen. Ein Beispiel: Wenn ein Stamm in Afrika glaubt, es gebe außerhalb ihres Dorfes keine Löwen, und ein Fremder warnt vor einem Angriff, ist dessen Aussage wahr, wenn Löwen tatsächlich kommen, unabhängig vom Konsens des Stammes. Wahrheit hängt nicht vom Konsens ab. Diese Theorie widerspricht sich zudem selbst: Wenn man sagt, Wahrheit bestehe nur im Konsens, beansprucht man für diese Aussage selbst objektive Wahrheit, was die Theorie widerlegt.
Auch pragmatische Wahrheitsbegriffe, die Wahrheit mit dem Gleichsetzen, was „funktioniert“ oder nützlich ist, sind problematisch. Dass eine Annahme praktisch wirkt, beweist nicht ihre Wahrheit. Eine egoistische Wirtschaftstheorie mag funktionieren, aber das macht sie nicht wahr oder gut.
Dieser klassische Wahrheitsbegriff ist nicht nur philosophisch und wissenschaftlich entscheidend, sondern auch im Glauben. Das christliche Glaubensbekenntnis setzt voraus, dass jede Aussage – etwa „Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde“ oder „Jesus Christus ist von der Jungfrau Maria geboren“ – wahr ist, weil sie mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Wenn man diese Wahrheit auf einen bloßen Konsens oder ein Mittel zur Bewältigung von Todesangst reduziert, verliert der Glaube seinen Sinn und wird zu einer Art „angenehmer Lüge“.
Auch ethisch ist die Wahrheit zentral. Die Suche nach Wahrheit und die Vermeidung von Irrtum und Lüge sind Grundtugenden. Jan Hus, der tschechische Reformator, der 1415 in Konstanz verbrannt wurde, betonte in seiner letzten Rede die Pflicht, die Wahrheit zu suchen und auszusprechen. Wahrheit ist die Grundlage für ethisches Handeln. Wenn wir etwa die Würde jedes Menschen anerkennen, folgt daraus, dass Handlungen wie die Tötung ungeborener Kinder moralisch falsch sind. Die Wahrheit des Urteils ist somit die Grundlage für Moral und Ethik in allen Lebensbereichen.