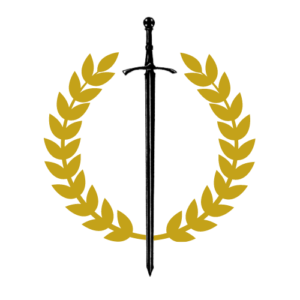Stimmen Sie dieser Einschätzung zu, dass die Kunst verwaist ist?
Martin Mosebach: Das ist ein großer Themenkomplex: Kirche und Kultur. Die Analyse von Thompson trifft zu: Die Kunst ist verwaist – oder sie ist selbst von ihrer Mutter, der Kirche, weggelaufen. Dabei muss man sagen, dass die Mutter sie auch nicht versucht hat zu halten. Diese Entwicklung ist ein langer Prozess, der sehr früh beginnt.
Die katholische Kirche und ihre Liturgie haben nach dem Untergang des weströmischen Reiches eine neue Kultur geschaffen. Sie hat das Beste der Antike in vollkommen neue Verhältnisse hineingetragen, in die germanischen Reiche, in die Länder, die aus dem Untergang des weströmischen Reiches hervorgingen. Die Kirche war sprachschöpferisch: Mit ihrer Liturgie, einem anonymen Fundamentalkunstwerk, hat sie eine Formensprache entwickelt, die außerordentlich fruchtbar wurde. Sie hat nicht nur den Untergang des weströmischen Reiches überdauern lassen, sondern etwas Neues, möglicherweise noch Reicheres geschaffen, als es die antiken Reiche waren.
Ein besonderes Element, das die Antike in diesem Sinne nicht kannte, war ein hierarchisches Priestertum. Dieses Priestertum verwaltete die Liturgie und die Theologie und machte etwas Neues möglich: die Freiheit der Kunst. Die großen, erhabenen Themen der Religion wurden von der Hierarchie, den Theologen und Päpsten verwaltet. Dadurch wurde der Dichtung, der Malerei und anderen Künsten eine gewisse Freiheit zugestanden, die immer mehr wuchs. Es war ein unerhörtes Experiment: Die Freiheit der Kunst ist im Schoß der Kirche gewachsen. Maler, Architekten und Dichter konnten, solange sie sich innerhalb der von der Theologie vorgegebenen Regeln bewegten, immer mehr Freiräume erobern. In der Malerei wurden Künstler sogar selbst zu Theologen, etwa wenn sich das Christus- oder Marienbild im Laufe der Jahrhunderte wandelte und die Kunst theologische Entwicklungen vorantrieb.
Dieses enorme Experiment zwischen der kirchlichen Hierarchie und der freien Kunst war von unermesslicher Fruchtbarkeit. Doch wie es mit Fruchtbarkeiten oft ist, gelangte es irgendwann an ein Ende. Die Freiheit der Kunst wurde immer radikaler in Anspruch genommen, und der Bezug zur liturgischen Bindung wurde immer weniger akzeptiert. Dies muss nicht unbedingt als Unglücksfall gesehen werden – es liegt in der Natur dieses Experiments, dass Freiheit irgendwann absolut wird und für die Liturgie und die Verkündigung des Glaubens unbrauchbar wird. Ein Künstler wie Tizian mit seinen freien Ausdeutungen führt schließlich zu einem Joseph Beuys, zu einer Kunst, die in einen radikalen Subjektivismus verfällt, der für die christliche Verkündigung bedeutungslos geworden ist.
Das große Konzept der künstlerischen Freiheit, das über tausend Jahre stattfand, ist an seinem Ende angelangt. Wir müssen zurück zu einer vollständig gebundenen Kunst für die Kirche, von der auch die profane Kunst profitieren könnte, die längst unter ihrer Maßstabslosigkeit leidet. Die Orthodoxie ist diesen Weg der Freigabe der Kunst nie gegangen. Die griechisch-orthodoxe Kirche besitzt noch immer brauchbare liturgische Kunst, die eng mit den liturgischen Vollzügen verbunden ist. Man könnte fast sagen, das Schisma sei ein Geschenk des Heiligen Geistes, da es eine nicht-individualistische, unfreie Kunst bewahrt hat.
Aber können Sie sagen, ob die eine Seite besser ist als die andere? Die griechisch-orthodoxe Bindung der Kunst bringt keine Dichter wie Goethe oder Schiller hervor.
Martin Mosebach: Das ist richtig. Die einzigartigen Fähigkeiten des Menschen, die sich in der Kunst des Abendlandes entfaltet haben, entwickelten sich im Osten weniger oder erst viel später, etwa in Russland, wo die Literatur im 19. Jahrhundert explosionsartig aufblühte. Die Frage, was besser ist – eine Liturgie, die zur Gottespräsenz führt, oder das individualistische Kunstwerk –, ist schwer zu beantworten. Was geschehen ist, hat sein eigenes Recht. Es war notwendig, weil es geschah, und es wird in der Welt bleiben. Selbst wenn wir in eine neue Phase kirchlich gebundener Kunst eintreten, wird die Vergangenheit immer präsent sein. Eine neue Ikonenkunst wird anders sein als die vor tausend Jahren.
Würden Sie sagen, dass eine solche Bindung der Kunst an die Kirche nur möglich ist, wenn die Kirche eine Strahlkraft besitzt, die durch eine entsprechend würdige Liturgie getragen wird?
Martin Mosebach: In großen Fragen sollte man auf Taktik verzichten und sich auf das Wahre und Richtige konzentrieren, den Ausgang hinnehmen, wie er kommt. Die antike Kunst war untergegangen, und es entstand eine anonyme Kunst durch Ikonen, romanische Werke und die sogenannten italienischen Primitiven. Diese Kunst schuf einen kulturellen Humus. Kultur ist, wie das Wort aus dem Ackerbau zeigt, eine Pflege des Bodens über Generationen hinweg. Man pflanzt Bäume, deren Früchte zukünftige Generationen ernten. Der westliche Mensch ist ungebärdig und wird sich nicht lange in Ketten legen lassen. Nach dem Experiment der Freiheit sollten wir getrost das Experiment der Gebundenheit wagen und sehen, was daraus entsteht.