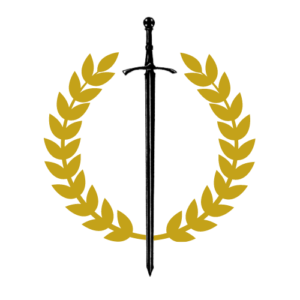Die Vorstellung, den Geist „herunterladen“ zu können, basiert darauf, dass Geistigkeit nicht als bewusst oder lebendig verstanden wird, sondern als eine Art Summe von Daten oder Informationen. Das ist der Funktionalismus. Der Funktionalismus behauptet, dass die Vorgänge, die in einem Computer ablaufen – also das Umwandeln von Informationen in elektronischen Einheiten –, im Prinzip dasselbe seien wie das, was im Gehirn passiert. Geist wird dabei als eine Art Computerprogramm verstanden, das aktuell abläuft. Das ist das algorithmisch-computationale Modell des Geistes.
Dieses Modell hat jedoch eine entscheidende Schwäche: In einem Computer werden ständig Informationen umgewandelt, und aus einem Input kann ein Output entstehen. Doch in keinem Computer finden Sie so etwas wie basale Erfahrungen von Gefühlen, etwa die Wahrnehmung von Rot oder Grün. All die qualitativen Erfahrungen, die die eigentliche Würze des Lebens und des Bewusstseins ausmachen, tauchen in reinen Informationen nicht auf. Sie haben also digitale Inhalte, aber was den digitalen Gehalt eines Lavendelgeruchs ausmachen soll, hat noch niemand herausgefunden. Der Lavendelgeruch ist eine einmalige, spezifisch bewusste Qualität, die sich nicht in digitale Informationen übersetzen lässt.
Die Behauptung, Geist sei ein reines Informationsset oder ein Informations-Komplex, ist philosophisch vollkommen unplausibel und wird durch unsere Erfahrung, die immer analog ist, nicht gestützt. Unsere Erfahrung ist ganzheitlich; wir nehmen unmittelbare Eindrücke wie Gerüche oder Farben als vollständige, nicht aus Pixeln oder einzelnen Daten zusammengesetzte Erlebnisse wahr. Der Funktionalismus hat hier eine entscheidende Schwäche. Zudem konnte noch niemand nachweisen, wie aus Daten so etwas wie Subjektivität, also ein Selbst-Erleben, entstehen kann.
Wenn Sie diese Kritik am Funktionalismus akzeptieren, wird klar, dass aus dem Gehirn vielleicht Informationen entnommen werden können. Als Neurowissenschaftler kann ich beispielsweise im MRT oder anderen Untersuchungen Vorgänge objektivieren. Zwischen Neuronen laufen Prozesse ab, die sich bis zu einem gewissen Grad als Informationen digitalisieren lassen. Aber das, was Bewusstsein ausmacht, ist etwas Leibliches, Körperliches, Lebendiges, das den gesamten Organismus braucht. Es lässt sich nicht aus einzelnen digitalen Informationen zusammensetzen.
Die Idee, alle Konfigurationen der Synapsen bis hin zu den elementaren Molekülen kopieren oder als Datenmenge erfassen zu können, ist ohnehin völlig abstrus. Selbst wenn dies theoretisch möglich wäre und Sie diese gesamte Datenmenge von Gehirn-, Neuronen- und Molekülkonfigurationen erfassen könnten, hätten Sie lediglich eine Informationsmenge – kein Bewusstsein. Bewusstsein ist an Körperlichkeit, Leiblichkeit und Lebendigkeit gebunden.
Der Gedanke des „Mind Uploads“ ist ein radikal dualistischer Gedanke, der den Geist als eine reine Informationsmenge beschreibt, fast idealistisch, als hätte er nichts mit stofflicher, organischer Lebendigkeit zu tun. Dieser Ansatz widerspricht jeder Biologie. Es ist eine einseitige Sicht auf die Komplexität des Menschen und seine Leiblichkeit.
In den kognitiven Neurowissenschaften arbeiten wir seit etwa 20 Jahren daran, dieses Bild zu vervollständigen: Körper und Geist sind nicht voneinander getrennt. Jeder kognitive, also gedankliche Vorgang hat eine körperliche Basis. Wir haben uns längst vom kartesianischen Dualismus, der Dichotomie von Körper und Geist, distanziert. Was an dieser ganzen Angelegenheit wundert, ist, dass die Vertreter des „Mind Uploads“ diese wissenschaftliche Entwicklung komplett ignorieren. Diese gut belegte Entwicklung, die in zahlreichen wissenschaftlichen Datenbanken nachvollzogen werden kann, wird einfach ausgeblendet. Sie sagen: „Für uns ist es so“, und halten an der Dichotomie fest, die uns lange behindert hat.
Diese dualistische Sicht hat die Kommunikationswissenschaft wie eine Kappe eingeschränkt. Selbst im 20. Jahrhundert wurde von bestimmten Schulen propagiert, dass Sprache ein Phänomen des Geistes sei, bestehend aus abstrakten Einheiten. Diese Vorstellung hat uns von den 1970er-Jahren bis in die 2000er-Jahre begleitet und die Entwicklung des Wissens gebremst.